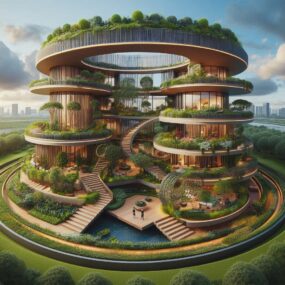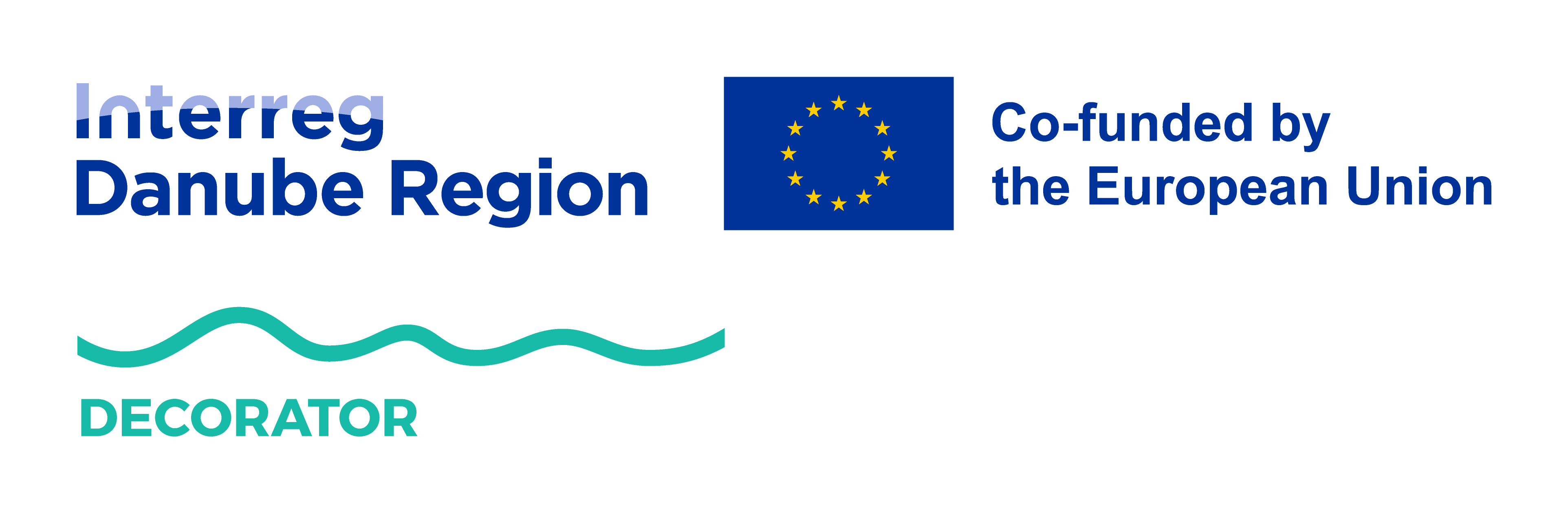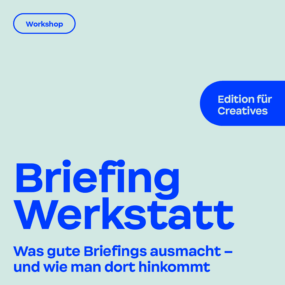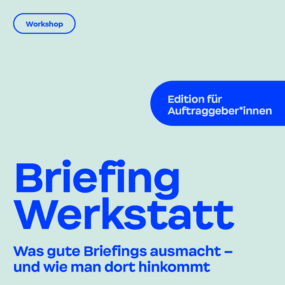Wie lassen sich Materialien, Bestand, Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle konkret zusammenbringen, wenn es um die Zukunft des Bauens geht? In Linz haben wir dazu zuletzt beispielhafte Projekte besucht, die zeigen, wie Bauen im Bestand, ressourcenschonende Materialien und innovative Planungskonzepte ineinandergreifen können – vom sorgfältig sanierten Altstadtgebäude über experimentelle Kreislaufarchitektur bis zum modernen Holz-Hybrid-Büro. Diese Beispiele machen deutlich, welche Hebel für den Wandel tatsächlich wirken.
Bestand als Ressource denken – nicht als Problem
Der Gebäudebestand ist einer der größten Rohstoffspeicher unserer Städte. Doch während wir über Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sprechen, wird vielerorts noch immer zu schnell der Abrissbagger geholt. Dabei liegt gerade im Weiterbauen, Umnutzen und klugen Sanieren das größte Potenzial für ressourcenschonendes, zukunftsfähiges Bauen.
Wer im Bestand arbeitet, weiß: Es braucht Erfahrung, Genauigkeit und den Mut, mit vorhandenen Strukturen umzugehen. Minimalinvasive Eingriffe, kluge Planung und lokale Materialien wie Lehm, Holz, Kalk oder Zellulose bieten konkrete Lösungen. Dabei entstehen nicht nur ökologisch bessere, sondern auch räumlich und atmosphärisch qualitätsvolle Orte.
Wie sich das in der Praxis zeigt, macht Tp3 Architekten an mehreren Beispielen in der Linzer Altstadt deutlich: Mit behutsamen Eingriffen, kluger Lichtführung und natürlichen Materialien wie Kalkputz, Zellulosedämmung und Holz werden historische Gebäude für eine zeitgemäße Nutzung weiterentwickelt. Dabei entsteht nicht nur klimafreundlicher Wohnraum, sondern auch neuer Raum für Lebensqualität im Bestand – ressourcenschonend, präzise und mit Respekt vor dem Vorhandenen.
„Bauen im Bestand ist immer auch eine Auseinandersetzung mit dem, was schon da ist. Es geht darum, mit Respekt weiterzudenken, nicht einfach zu ersetzen.“
Markus Rabengruber, Tp3 Architekten

1 | 8
Mit den Tp3 Architekten durch die Linzer Altstadt

2 | 8
Mit den Tp3 Architekten durch die Linzer Altstadt

3 | 8
Mit den Tp3 Architekten durch die Linzer Altstadt

4 | 8
Mit den Tp3 Architekten durch die Linzer Altstadt

5 | 8
Mit den Tp3 Architekten durch die Linzer Altstadt

6 | 8
Mit den Tp3 Architekten durch die Linzer Altstadt

7 | 8
Mit den Tp3 Architekten durch die Linzer Altstadt

8 | 8
Mit den Tp3 Architekten durch die Linzer Altstadt
Materialkreisläufe beginnen vor Ort
Materialien, die direkt auf der Baustelle wiederverwendet oder weiterverarbeitet werden, zeigen, wie pragmatisch Kreislaufwirtschaft funktionieren kann: Was lokal bleibt, spart Ressourcen und Emissionen. Schwieriger wird es, sobald Materialien in größere Kreisläufe eingebracht werden sollen – hier fehlen noch oft logistische, rechtliche und wirtschaftliche Strukturen.
Die Zukunft verlangt ein stärkeres Bewusstsein für den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden: von der Planung über den Betrieb bis zum Rückbau. Materialwissen wird wieder wichtiger, ebenso wie die Bereitschaft, Bauprozesse neu zu denken.
Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für kreislauffähiges Bauen im Bestand liefert das Stadthaus Lederergasse von mia2 Architektur. Das ursprünglich aus dem 16. Jahrhundert stammende Gebäude wurde behutsam für zeitgemäßes Wohnen und Arbeiten transformiert – und dabei als Experimentierfeld für zirkuläre Bauweisen genutzt.
Stampflehmwände aus dem eigenen Aushub, Holz-Beton-Verbunddecken sowie modulare Fertigteile zeigen, wie sich lokale Ressourcen, kluge Konstruktionen und zukünftige Rückbaufähigkeit verbinden lassen. Der Bestand bleibt erhalten, der ökologische Fußabdruck wird minimiert. Der begrünte Innenhof schafft zusätzlichen Mehrwert für Klima und Gemeinschaft. Das Projekt beweist, wie mit architektonischem Feingefühl, Materialkompetenz und einem klaren Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft neue Qualitäten in innerstädtischen Strukturen entstehen können.
„Wenn wir über Kreislaufwirtschaft sprechen, müssen wir bei den Materialien beginnen – aber genauso bei der Frage, wie wir Räume nutzen und wie flexibel Gebäude bleiben dürfen.“
Sandra Gnigler, mia2 Architektur

1 | 6
Mit mia2 Architektur zu Besuch im Stadthaus Lederergasse

2 | 6
Mit mia2 Architektur zu Besuch im Stadthaus Lederergasse

3 | 6
Mit mia2 Architektur zu Besuch im Stadthaus Lederergasse

4 | 6
Mit mia2 Architektur zu Besuch im Stadthaus Lederergasse

5 | 6
Mit mia2 Architektur zu Besuch im Stadthaus Lederergasse

6 | 6
Mit mia2 Architektur zu Besuch im Stadthaus Lederergasse
Digitalisierung als Türöffner für Präzision und Qualität
Digitale Werkzeuge wie der digitale Zwilling oder präzises 3D-Aufmaß erleichtern heute den Umgang mit komplexem Bestand. Sie schaffen Planungs- und Ausführungssicherheit und ermöglichen eine präzisere Steuerung von Materialien und Ressourcen.
Auch Robotik und Vorfertigung sind Teil dieser Entwicklung. Effizienz und Qualitätssicherung sind keine Widersprüche mehr zu nachhaltigem Bauen – im Gegenteil: Sie sind Voraussetzung.
Ein gelungenes Beispiel dafür liefert das MIC Headquarters in Linz. Das moderne Bürogebäude wurde von DELTA gemeinsam mit Architekt Bernhard Rihl geplant, OFFORA verantwortete das Interior Design, die Ausführung übernahm Swietelsky. Der Holz-Beton-Hybridbau setzt auf erneuerbare Materialien, Photovoltaik, begrünte Dächer und smarte Gebäudetechnologie. Neben der Ökobilanz standen Flexibilität, Aufenthaltsqualität und soziale Aspekte im Fokus: Das Gebäude bietet helle, zonierte Arbeitswelten sowie eine öffentlich zugängliche Kantine, die auch das Quartier belebt.
Das Projekt zeigt, wie ökologische, soziale und wirtschaftliche Anforderungen in einem Neubau vereint werden können – mit einer ÖGNI-Gold-Zertifizierung für nachhaltige Bauweise als Bestätigung. Zugleich macht es deutlich, wie technologische Lösungen wie digitale Planungstools, PV-Systeme und intelligentes Energiemanagement zur Ressourcenschonung und Zukunftsfähigkeit beitragen. Das MIC Gebäude ist damit ein Vorbild für verantwortungsvolles, zukunftsfähiges Gewerbebauen, das seine Wirkung auch über das eigene Grundstück hinaus entfaltet.
„Nachhaltiges Bauen ist nicht nur eine Frage der Technik, sondern eine Frage des Zusammenspiels: von Architektur, Nutzung und Verantwortung für das Umfeld.“
Bernhard Rihl, Architekt
–> Mehr zum Projekt: Warum Raumgefühl mehr ist als Design – Wie OFFORA und MIC gemeinsam das neue Bürogebäude zu einem Ort für Kultur, Kommunikation und Konzentration machten

1 | 4
Zu Besuch bei MIC in Linz

2 | 4
Zu Besuch bei MIC in Linz

3 | 4
Zu Besuch bei MIC in Linz

4 | 4
Zu Besuch bei MIC in Linz
Neue Geschäftsmodelle: Rollen neu denken, Verantwortung teilen
Zukunftsfähiges Bauen erfordert nicht nur neue Technologien, sondern auch ein Umdenken bei den Geschäftsmodellen. Ein wichtiger Hebel liegt im Bestand selbst: Wer im Bestand arbeitet, arbeitet präziser, braucht mehr Planungstiefe und zahlt direkt auf den Lebenszyklus eines Gebäudes ein. Minimalinvasives Sanieren, Reduktion von Betriebskosten und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen machen Bestandsentwicklung auch wirtschaftlich attraktiv – etwa für leistbaren Wohnraum.
Qualitatives Bestandsaufmaß, frühzeitige Abstimmung mit Fachplaner:innen (Brandschutz, Bauphysik, Akustik, Elektro) und eine enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Handwerksbetrieben werden zu zentralen Erfolgsfaktoren. Ebenso verändern sich die Anforderungen an Raumkonzepte: Flexibilität, Zonierung und geteilte Infrastrukturen – wie am Beispiel des MIC Headquarters – werden Teil eines neuen Verständnisses von nachhaltiger Nutzung.
Auch im Vertragswesen braucht es neue Denkansätze: Kollaborative Planungskulturen, Mehrparteienverträge und faire Risikoteilung stärken das Vertrauen zwischen Planung und Ausführung und schaffen die Grundlage für Projekte, die nicht nur nachhaltig gebaut, sondern auch nachhaltig betrieben werden.
Das Projekt von mia2 zeigt eindrucksvoll, wie Architekt*innen selbst Verantwortung übernehmen können, indem sie ihr eigenes Gebäude als Experimentierfeld nutzen – nicht nur planerisch, sondern auch als Betreiber*innen und Bewohner*innen. So wird aus Theorie gelebte Praxis.

1 | 3
Kollaboration im Bauwesen

2 | 3
Kollaboration im Bauwesen

3 | 3
Kollaboration im Bauwesen
Stadt neu denken: kurze Wege, geteilte Räume, lebenswerte Quartiere
Nachhaltiges Bauen endet nicht am Grundstücksrand. Wer über Zukunft nachdenkt, denkt in Quartieren: Geteilte Ressourcennutzung, kurze Wege, Flexibilität der Nutzung sind die Bausteine der 15-Minuten-Stadt. Eine Kantine kann auch ein Quartiersrestaurant sein, eine Tiefgarage eine Infrastruktur für viele.
Das MIC-Gebäude in Linz macht dies erlebbar: Die öffentlich zugängliche Kantine und Überlegungen zu gemeinschaftlich nutzbaren Flächen (Parken, Begegnung, Arbeiten) zeigen, wie ein Unternehmensgebäude Mehrwert für sein Umfeld schaffen kann.
So entstehen Orte, die nicht nur ökologisch, sondern auch sozial resilient sind. Wo Lebensqualität steigt, sinkt der Mobilitätsdruck. Wo Räume geteilt werden, werden Ressourcen geschont.
Fazit: Nachhaltigkeit beginnt mit dem Blick auf das, was da ist.
Die Zukunft liegt nicht im immer Neuen, sondern im klugen Umgang mit dem Bestehenden. Es braucht einen Kulturwandel im Bauen – von der ressourcenintensiven Objektfixierung hin zu einer Planung, die den Kontext, die Lebenszyklen und das Gemeinsame in den Mittelpunkt stellt.
Wer Kreislaufwirtschaft ernst nimmt, fängt nicht beim Abriss an, sondern beim genaueren Hinsehen. Bestand ist Ressource. Bestand ist Zukunft.
Doch die Beispiele zeigen auch: Kreislaufgerechtes Bauen und die Weiterentwicklung von Beständen verlangen mehr als technisches Wissen oder neue Materialien. Sie erfordern ein Umdenken in den Geschäftsmodellen und Planungsprozessen:
- Einfachheit im Bauen, klare Eingriffe und der Mut zur Reduktion helfen, Kosten zu senken und Ressourcen zu schonen.
- Frühzeitige Kooperation zwischen Planung, Ausführung und Handwerk wird zum Erfolgsfaktor.
- Digitale Werkzeuge und präzises Bestandsaufmaß sichern Qualität und Effizienz.
- Architekt:innen werden zu Entwickler:innen und Betreiber:innen, übernehmen Verantwortung für das, was sie gestalten.
- Gute Raumkonzepte denken von Anfang an flexibel und gemeinschaftlich – vom geteilten Arbeitsraum bis zur Quartiersgarage.
Das alles braucht einen Wandel in der Planungskultur, Vertrauen in Kooperation, den Austausch von Wissen und den Mut, nicht nur das Gebäude, sondern auch das Umfeld und seine Nutzung neu zu denken.
Die Erkenntnisse dieser Projekte und des Workshops sind klar: Wer Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und Zusammenarbeit als integrale Bestandteile von Baukultur versteht, gestaltet nicht nur nachhaltigere Gebäude, sondern auch zukunftsfähige Städte.
Dieser Artikel entstand im Rahmen des EU Projektes DECORATOR und unserer damit verbundenen Auseinandersetzung mit Zukunftsfragen der Bauwirtschaft, Stadtentwicklung und Kreislaufwirtschaft. Gefördert wird das Projekt aus dem Programm Interreg Danube Transnational.
Der Artikel ist eine Zusammenfassung der Dokumentation von nonconform zu „Architektur im Wandel – Journey zu nachhaltiger Architektur in Linz“ am 17. Juni 2025. Die komplette Dokumentation findest du hier: Workshop Creative Journey – Architektur im Wandel